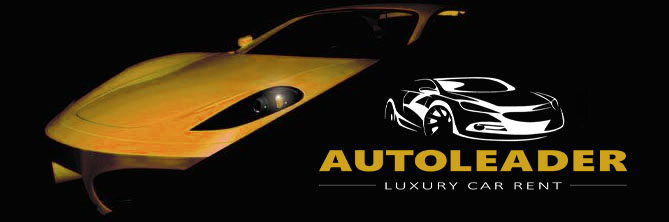Grenzgänger im Tessin: Krise oder Wandel? Die Zukunft der grenzüberschreitenden Arbeit
Beitrag vom: 18.08.2025

Grenzgänger im Tessin: Krise oder Wandel? Die Zukunft der grenzüberschreitenden Arbeit
Das Titelbild dieses Magazins führt uns mit seinem Hinweis auf den Zoll direkt zum Kern des Problems. Die Grenze, einst ein Symbol für Chancen und Integration, scheint heute eine neue Realität zu beschreiben, die von sinkenden Zahlen und Fragen zur Zukunft geprägt ist. Dabei handelt es sich nicht nur um eine einfache Statistik, sondern um ein Phänomen, das Tausende von Familien sowohl in Italien als auch in der Schweiz betrifft und direkte Auswirkungen auf wichtige Sektoren der Tessiner Wirtschaft hat, vom Gesundheitswesen bis zur Industrie, von den Dienstleistungen bis zum Handel.
Dieser Artikel versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, indem er die Ursachen dieses Rückgangs, die Folgen für das Tessin und für die Grenzgänger selbst sowie mögliche Zukunftsperspektiven analysiert. Es geht nicht nur um Zahlen und Statistiken, sondern auch um Geschichten, Zeugnisse und Analysen, um ein komplexes Phänomen zu verstehen, das das Gesicht des Tessiner Arbeitsmarktes neu prägt. Bereiten Sie sich auf eine Reise in das Herz eines Wandels vor, der die Beziehungen zwischen dem Tessin und seinen grenzüberschreitenden Nachbarn für immer verändern könnte.
Das Grenzgängerphänomen im Tessin: Ein wirtschaftlicher Pfeiler
Um das Ausmaß des Rückgangs der Zahl der Grenzgänger vollständig zu verstehen, ist es unerlässlich, einen Schritt zurückzutreten und die Rolle zu analysieren, die diese Arbeitnehmer schon immer in der Tessiner Wirtschaft gespielt haben. Seit Jahrzehnten stellen die italienischen Grenzgänger eine unersetzliche Ressource für den Kanton dar, da sie Lücken auf dem lokalen Arbeitsmarkt füllen und wesentlich zum Wachstum und zur Entwicklung zahlreicher Sektoren beitragen.
Das Tessin mit seiner dynamischen Wirtschaft und seiner geografischen Nähe zu Italien hat schon immer zahlreiche Arbeitskräfte aus den Nachbarregionen, insbesondere aus der Lombardei und dem Piemont, angezogen. Diese Arbeitnehmer, die oft hoch qualifiziert sind und über spezifische Fähigkeiten verfügen, haben im Kanton Tessin Beschäftigungsmöglichkeiten und günstigere Lohnbedingungen als in ihrem Herkunftsland gefunden. Gleichzeitig profitieren die Tessiner Unternehmen von einem Pool flexibler und qualifizierter Arbeitskräfte, die für die Produktion und die Erbringung von Dienstleistungen unverzichtbar sind.
Branchen wie das Gesundheitswesen, die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe und der Handel sind in hohem Maße von den grenzüberschreitenden Arbeitskräften abhängig. In den Tessiner Krankenhäusern und Kliniken kommen viele Ärzte, Krankenschwestern und medizinisches Personal aus Italien. In den Fabriken spielen Grenzgänger eine wichtige Rolle in der Produktion und Montage. Auf den Baustellen ist ihre Anwesenheit entscheidend für die Fertigstellung der Projekte. Diese wechselseitige Abhängigkeit hat ein integriertes Wirtschaftssystem geschaffen, in dem der Wohlstand des Tessins eng mit der Verfügbarkeit und der Stabilität der Grenzgänger verbunden ist.
Die Zahlen sprechen für sich: Seit Jahren steigt die Zahl der G-Bewilligungen (die für Grenzgänger ausgestellt werden) stetig an und erreicht beachtliche Spitzenwerte. Diese positive Entwicklung hat dazu beigetragen, die Arbeitslosigkeit im Kanton tief zu halten und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Bei den Grenzgängern handelt es sich nicht nur um Arbeitnehmer, sondern auch um Konsumenten, die zur lokalen Wirtschaft beitragen, und in vielen Fällen um Personen, die sich in das soziale Gefüge des Tessins integrieren und gleichzeitig ihren Wohnsitz in Italien beibehalten.
Durch ihre Anwesenheit konnte sich das Tessin auf Sektoren mit hoher Wertschöpfung spezialisieren, in denen die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften hoch ist. Ohne die Grenzgänger hätten viele Unternehmen Schwierigkeiten, das für ihre Tätigkeit erforderliche Personal zu finden, und es bestünde die Gefahr einer Verlagerung oder eines Produktionsrückgangs. Deshalb hat der jüngste Rückgang der Grenzgängerzahlen eine gewisse Besorgnis ausgelöst, nicht nur bei den direkt Betroffenen, sondern auch bei den wirtschaftlichen und politischen Akteuren des Kantons.
Das Phänomen der Grenzgänger ist also weit mehr als nur eine Frage der Zahlen; es ist ein strukturelles Element der Tessiner Wirtschaft, ein Pfeiler, der seit Jahrzehnten Wachstum und Wohlstand stützt. Diese Realität zu verstehen, ist der erste Schritt, um sich den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu stellen und Lösungen zu finden, die die langfristige Nachhaltigkeit des Tessiner Arbeitsmarktes gewährleisten.
Das Fiskalabkommen 2020: Der Funke des Wandels
Wenn es ein Ereignis gibt, das den Tessiner Grenzübergang in seinen Grundfesten erschüttert hat, dann ist es zweifelsohne das Inkrafttreten des neuen Fiskalabkommens zwischen der Schweiz und Italien im Jahr 2020. Dieses Abkommen, das das veraltete Abkommen aus dem Jahr 1974 ablöste, brachte erhebliche Änderungen in der Besteuerung der Grenzgänger mit sich, die nicht wenige Bedenken hervorriefen und offenbar zum jüngsten Rückgang ihrer Zahl beitrugen.
Das Hauptziel des neuen Abkommens bestand darin, die Steuervorschriften zu modernisieren und die Doppelbesteuerung zu vermeiden, um mehr Gerechtigkeit und Transparenz zu gewährleisten. Die neuen Bestimmungen hatten jedoch unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, ob es sich um "alte" oder "neue" Grenzgänger handelt. Die ³ealten³c Grenzgänger, d. h. diejenigen, die vor Inkrafttreten des Abkommens in der Schweiz gearbeitet haben, profitieren weiterhin von einer günstigeren Übergangsregelung mit fast ausschließlicher Besteuerung in der Schweiz und einer Ausgleichsabgabe an Italien.
Für die ³eneuen³c Grenzgänger hingegen haben sich die Dinge grundlegend geändert. Das neue System sieht eine konkurrierende Besteuerung vor, was bedeutet, dass die Einkünfte sowohl in der Schweiz als auch in Italien besteuert werden. In der Schweiz wird eine Quellensteuer auf 80 % des Bruttoeinkommens erhoben, während das Einkommen in Italien nach den üblichen Sätzen besteuert wird, wobei die Möglichkeit besteht, einen erhöhten Freibetrag (von 7.500 EUR auf 10.000 EUR) in Anspruch zu nehmen. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, erkennt Italien eine Steuergutschrift für bereits in der Schweiz gezahlte Steuern an.
Diese Änderung, die zwar durch die Notwendigkeit einer Anpassung der Steuergesetzgebung an die moderne Zeit gerechtfertigt ist, hat die Arbeit im Tessin für neue Mitarbeiter weniger attraktiv gemacht. Während früher der Steuervorteil einen starken Anreiz darstellte, hat sich der Steuerunterschied zwischen den beiden Ländern verringert, so dass die Option "Grenze" für viele weniger attraktiv ist. Simulationen mehrerer Steuerstudien haben gezeigt, dass ein "neuer" Grenzgänger bei gleichem Einkommen eine deutlich höhere Gesamtsteuerlast zahlt als ein "alter" Grenzgänger.
Das Abkommen führte auch eine Definition des "Grenzgängers" ein, die auf dem Wohnsitz in einer Gemeinde innerhalb von 20 km von der Grenze und der täglichen Rückkehr beruht. Damit wurde eine klare Unterscheidung zwischen 'in-band' und 'out-of-band' Grenzgängern mit unterschiedlichen Steuerregelungen geschaffen. Diese zusätzliche Komplexität hat zu Unsicherheiten geführt und in einigen Fällen die Arbeitnehmer dazu veranlasst, ihre Arbeitsentscheidungen zu überdenken.
Es ist wichtig zu betonen, dass das Steuerabkommen nicht der einzige Faktor ist, der eine Rolle spielt, aber es ist sicherlich einer der wichtigsten. Es hat als Katalysator gewirkt und einen Veränderungsprozess beschleunigt, der vielleicht schon im Gange war, sich aber jetzt deutlicher manifestiert. Die Auswirkungen gehen über den rein fiskalischen Aspekt hinaus, beeinflussen individuelle Entscheidungen und Unternehmensstrategien und gestalten die grenzüberschreitende Arbeitsmarktlandschaft im Tessin neu.
Die Folgen des neuen Steuerregimes: Eine vertiefte Analyse
Die Einführung des neuen Steuerabkommens hat eine Reihe von direkten und indirekten Folgen ausgelöst, die den Tessiner Arbeitsmarkt prägen. Der Rückgang der Zahl der Grenzgänger ist zwar nicht drastisch, aber ein nicht zu übersehendes Signal, das eine gründliche Analyse seiner Auswirkungen erfordert.
Die offensichtlichste Tatsache ist zunächst die Abnahme der Attraktivität des Tessins für neue Grenzgänger. Während das Lohn- und Steuergefälle früher ein sehr starker Anreiz war, ist der wirtschaftliche Vorteil durch die konkurrierende Besteuerung nun geringer geworden. Dies hat dazu geführt, dass viele potenzielle neue Grenzgänger die Arbeit in der Schweiz überdenken und sich vielleicht für eine Stelle in Italien oder anderen Regionen entscheiden.
Die jüngsten Statistiken zeigen einen stetigen Rückgang der Zahl der ausgestellten G-Bewilligungen, im Gegensatz zum allgemeinen Anstieg in der Schweiz. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein spezifisches Tessiner Problem handelt, das genau mit den neuen steuerlichen Bedingungen zusammenhängt. Einige Zahlen deuten auf einen Rückgang von etwa 1.500 Arbeitsplätzen innerhalb von zwei Jahren hin, was für einen Kanton von der Größe des Tessins beachtlich ist.
Die Folgen sind auch auf der Ebene des Arbeitskräfteangebots zu spüren. Die Tessiner Unternehmen, vor allem diejenigen, die am stärksten auf grenzüberschreitende Arbeitskräfte angewiesen sind, haben Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden. Dies kann zu höheren Arbeitskosten, Verzögerungen in der Produktion oder bei der Erbringung von Dienstleistungen und letztlich zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führen. Bestimmte Sektoren wie das Gesundheitswesen und das Baugewerbe sind diesem Risiko besonders ausgesetzt.
Ein weiterer Nebeneffekt ist die Zunahme der Zahl der italienischen Arbeitnehmer, die sich für einen Umzug ins Tessin entscheiden. Wenn das grenzüberschreitende Pendeln weniger bequem wird, könnte die Option, sich in der Schweiz niederzulassen, für einige attraktiver werden. Dieses Phänomen kann zwar den Rückgang der Zahl der Grenzgänger teilweise kompensieren, wirft aber auch neue Fragen im Zusammenhang mit der Integration, den Sozialdiensten und dem Druck auf die lokale Infrastruktur auf.
Die neuen steuerlichen Auflagen haben auch ein Gefühl der Ungewissheit und Frustration unter den alten und neuen Grenzgängern hervorgerufen. Viele fühlen sich durch ein System, das sie als weniger gerecht empfinden, benachteiligt, was sich auf ihre Motivation und Loyalität gegenüber dem Unternehmen auswirken kann. Der Umgang mit dieser menschlichen Dynamik ist für die Tessiner Unternehmen von entscheidender Bedeutung, denn sie müssen Wege finden, um die Moral und die Produktivität ihrer Mitarbeiter hoch zu halten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wichtigsten Folgen des neuen Steuerregimes sind:
- Reduzierung der Attraktivität des Tessins für neue Grenzgänger.
- Erhöhte Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung für Tessiner Unternehmen.
- Erhöhte Arbeitskosten und möglicher Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.
- Verstärkte Wohnsitzverlagerung von Italien ins Tessin.
- Verunsicherung und Frustration bei den Grenzgängern.
Es ist klar, dass das neue Steuerabkommen zwar edle Absichten verfolgt, aber eine Reihe von Kettenreaktionen ausgelöst hat, die die grenzüberschreitende Arbeitslandschaft neu definieren. Das Verständnis dieser Dynamik ist der erste Schritt zur Entwicklung wirksamer Strategien, mit denen die negativen Auswirkungen gemildert und die Herausforderungen in Chancen für die Zukunft des Tessins umgewandelt werden können.
Neben der Besteuerung: Andere Faktoren, die den Zustrom beeinflussen
Obwohl das neue Steuerabkommen ein entscheidender Faktor für den Rückgang der Grenzgänger ist, wäre es zu kurz gegriffen, ihm die gesamte Verantwortung zuzuschreiben. Vielmehr gibt es noch andere, oft weniger offensichtliche, aber ebenso einflussreiche Faktoren, die dazu beitragen, den Strom der Grenzgänger im Tessin zu formen. Die Analyse dieser Faktoren ermöglicht eine umfassendere und vielschichtigere Betrachtung des Phänomens.
Einer der zu berücksichtigenden Aspekte sind die Lebenshaltungskosten im Tessin. Obwohl die Löhne in der Schweiz generell höher sind, sind die Lebenshaltungskosten, insbesondere für Mieten, Konsumgüter und Dienstleistungen, deutlich höher als in Italien. Dies kann einen Teil des wirtschaftlichen Vorteils eines höheren Gehalts zunichte machen und die Idee, in der Schweiz zu arbeiten, weniger attraktiv machen, insbesondere für Personen, die eine Familie haben oder einen gewissen Lebensstandard beibehalten wollen. Die Wahrnehmung einer geringeren Kaufkraft trotz eines höheren Nominallohns kann Neueinsteiger entmutigen.
Ein weiterer Faktor ist die Dynamik des italienischen Arbeitsmarktes. Obwohl Italien Zeiten der Wirtschaftskrise erlebt hat, gibt es Sektoren und Regionen, die Anzeichen einer Erholung zeigen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Ein dynamischerer italienischer Arbeitsmarkt mit steigenden Löhnen und besseren Vertragsbedingungen könnte den Drang zur grenzüberschreitenden Arbeitssuche verringern. Außerdem ist die Möglichkeit, in der Nähe des Wohnortes zu arbeiten und lange und kostspielige tägliche Pendelfahrten zu vermeiden, für viele Arbeitnehmer ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Der Aspekt der Lebensqualität und des persönlichen Wohlbefindens sollte nicht unterschätzt werden. Das tägliche Pendeln, das oft durch lange Warteschlangen an der Grenze und anstrengende Fahrtzeiten gekennzeichnet ist, kann die Lebensqualität von Grenzgängern erheblich beeinträchtigen. Stress, Müdigkeit und die Zeit, die der Familie und persönlichen Aktivitäten entzogen wird, können einige dazu veranlassen, nach Arbeitslösungen zu suchen, die näher an ihrem Wohnort liegen, selbst auf Kosten eines etwas niedrigeren Gehalts. Die Suche nach einer besseren Work-Life-Balance wird für immer mehr Menschen zu einer Priorität.
Schliesslich könnte sich die Wahrnehmung der Schweiz und des Tessins als Arbeitsort ändern. Nachrichten über neue Steuererhebungen, bürokratische Schwierigkeiten oder soziale Spannungen im Zusammenhang mit dem Grenzübertritt können ein weniger einladendes Bild vermitteln. Obwohl das Tessin nach wie vor eine solide, chancenreiche Wirtschaft ist, kann eine negative Wahrnehmung, auch wenn sie nicht ganz unbegründet ist, individuelle und kollektive Entscheidungen beeinflussen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass neben den steuerlichen Faktoren folgende Faktoren den Strom der Grenzgänger beeinflussen:
- Hohe Lebenshaltungskosten im Tessin.
- Dynamik des italienischen Arbeitsmarktes (Chancen und Löhne).
- Lebensqualität und persönliches Wohlbefinden (Auswirkungen des Pendelns).
- Wahrnehmung des Tessins als Arbeitsort.
Das Verständnis dieses komplexen Zusammenspiels von Faktoren ist entscheidend, um Politiken und Strategien zu entwickeln, die nicht nur auf die Steuerproblematik reagieren, sondern das Grenzphänomen in seiner Gesamtheit angehen und so die langfristige Nachhaltigkeit und Attraktivität des Tessiner Arbeitsmarktes gewährleisten.
Die Zukunft der grenzüberschreitenden Arbeit: Herausforderungen und Chancen
Der Rückgang der Grenzgänger im Tessin stellt zwar eine unmittelbare Herausforderung dar, kann aber auch als Katalysator für ein Umdenken und die Erneuerung des kantonalen Arbeitsmarktes gesehen werden. Die Zukunft der grenzüberschreitenden Arbeit ist nicht geschrieben, sondern wird von der Fähigkeit des Tessins abhängen, sich anzupassen und neue Chancen zu nutzen.
Eine der Hauptchancen liegt in der Aufwertung der lokalen Arbeitskräfte. Der Rückgang der Zahl der Grenzgänger könnte die Unternehmen dazu veranlassen, mehr in die Ausbildung und Qualifizierung der einheimischen Arbeitskräfte zu investieren, wodurch neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Tessiner entstehen und die Abhängigkeit von externen Arbeitskräften verringert wird. Dies könnte zu einer Stärkung des lokalen sozialen und wirtschaftlichen Gefüges führen, mit langfristigen Vorteilen für die gesamte Gemeinschaft.
Eine weitere Chance liegt in der wirtschaftlichen Diversifizierung. Das Tessin könnte sich auf die Entwicklung von Sektoren mit hoher Wertschöpfung konzentrieren, die spezialisierte Fähigkeiten erfordern und weniger abhängig von großen Mengen an Arbeitskräften sind. Sektoren wie Forschung und Entwicklung, Hightech, innovative Finanz- und Beratungsdienstleistungen könnten Talente aus der ganzen Welt anziehen und ein widerstandsfähigeres wirtschaftliches Ökosystem schaffen, das weniger anfällig für Schwankungen der Grenzströme ist.
Digitalisierung und Automatisierung spielen in diesem Szenario eine entscheidende Rolle. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien kann die Produktivität steigern und den Bedarf an Arbeitskräften für sich wiederholende Aufgaben verringern, so dass Unternehmen auch mit weniger Mitarbeitern wettbewerbsfähig bleiben können. Dies bedeutet nicht die Abschaffung von Arbeitsplätzen, sondern vielmehr deren Umwandlung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die digitale und analytische Fähigkeiten erfordern.
Die unmittelbarste Herausforderung ist das Management des Übergangs. Der Rückgang der Grenzgänger kann nicht passiv bewältigt werden, sondern erfordert eine aktive Politik, um die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt abzumildern und die Unternehmen im Anpassungsprozess zu unterstützen. Dazu gehören Ausbildungs- und Umschulungsprogramme, Anreize für die Einstellung von Einheimischen und ein ständiger Dialog mit Berufsverbänden und Gewerkschaften.
Eine weitere Herausforderung ist die Erhaltung der Lohnwettbewerbsfähigkeit. Wenn das Tessin weiterhin Talente aus dem In- und Ausland anziehen will, muss es wettbewerbsfähige Löhne und attraktive Arbeitsbedingungen garantieren. Dies bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Unternehmen und den Erwartungen der Arbeitnehmer zu finden und einen Wettlauf nach unten zu vermeiden, der der gesamten kantonalen Wirtschaft schaden könnte.
Schliesslich ist es entscheidend, einen konstruktiven Dialog mit Italien zu führen. Trotz fiskalischer Unterschiede bleibt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Wohlstand beider Regionen unerlässlich. Die Suche nach gemeinsamen Lösungen, die Förderung gemeinsamer Projekte und der Austausch bewährter Verfahren können dazu beitragen, die Beziehungen zu stärken und Herausforderungen in Chancen für ein gemeinsames Wachstum zu verwandeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der grenzüberschreitenden Arbeit im Tessin gekennzeichnet ist durch:
- Chancen:
- Aufwertung der lokalen Arbeitskräfte.
- Diversifizierung der Wirtschaft hin zu Sektoren mit hoher Wertschöpfung.
- Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung und Automatisierung.
- Herausforderungen:
- Übergangsmanagement und Abfederung negativer Auswirkungen.
- Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Löhne.
- Die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs mit Italien.
Das Tessin hat die Möglichkeit, diese Phase des Wandels in eine Chance zu verwandeln, um einen widerstandsfähigeren, innovativeren und nachhaltigeren Arbeitsmarkt aufzubauen, der in der Lage ist, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und den Wohlstand aller Einwohner zu sichern.
Schlusswort: Ein neues Kapitel für die Arbeit im Tessin
Der Rückgang der Zahl der Grenzgänger im Tessin ist keine bloße Statistik, sondern das Zeichen eines tiefgreifenden Wandels, der den kantonalen Arbeitsmarkt betrifft. Das Steuerabkommen 2020 hat als Katalysator gewirkt und eine Dynamik beschleunigt, die vielleicht schon vorhanden war, sich aber nun deutlicher manifestiert. Es wäre jedoch ein Fehler, die Analyse auf einen einzigen Faktor zu beschränken und die Rolle der Lebenshaltungskosten, der Möglichkeiten auf dem italienischen Arbeitsmarkt und der Suche nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu vernachlässigen.
Das Tessin steht vor einer entscheidenden Entscheidung: diese Veränderungen passiv hinzunehmen oder sie als Chance zu nutzen, um eine widerstandsfähigere und innovativere Zukunft aufzubauen. Die Aufwertung der lokalen Arbeitskräfte, die Diversifizierung der Wirtschaft hin zu Sektoren mit hoher Wertschöpfung und die Einführung fortschrittlicher Technologien sind der Schlüssel zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und zur Sicherung des Wohlstands des Kantons.
Der ständige Dialog mit Italien, die Suche nach gemeinsamen Lösungen und die Fähigkeit zur Anpassung sind der Schlüssel zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und der Attraktivität des Tessins als Arbeitsort. Die Geschichte des Kantons ist gespickt mit Beispielen dafür, wie die Tessinerinnen und Tessiner den Herausforderungen mit Pragmatismus und Weitsicht begegnen konnten. Einmal mehr hat das Tessin alle Trümpfe in der Hand, um ein neues Kapitel zu schreiben, in dem die grenzüberschreitende Arbeit, wenn auch im Wandel begriffen, weiterhin eine wertvolle Ressource sein wird, allerdings in einem ausgewogeneren und nachhaltigeren Kontext.
Die Zukunft ist ungewiss, aber eines ist klar: Das Tessin gibt nicht auf. Mit Intelligenz, Flexibilität und einer gehörigen Portion Innovation wird der Kanton diese Turbulenzen zu meistern wissen und gestärkt aus ihnen hervorgehen, um den Herausforderungen von morgen gewachsen zu sein. Und wir von SwissMag werden Sie Schritt für Schritt darüber informieren.
Cookies & Privacy
Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web.
Accetta e continua Continua senza accettare
Per maggiori informazioni leggi la nostra Privacy Policy